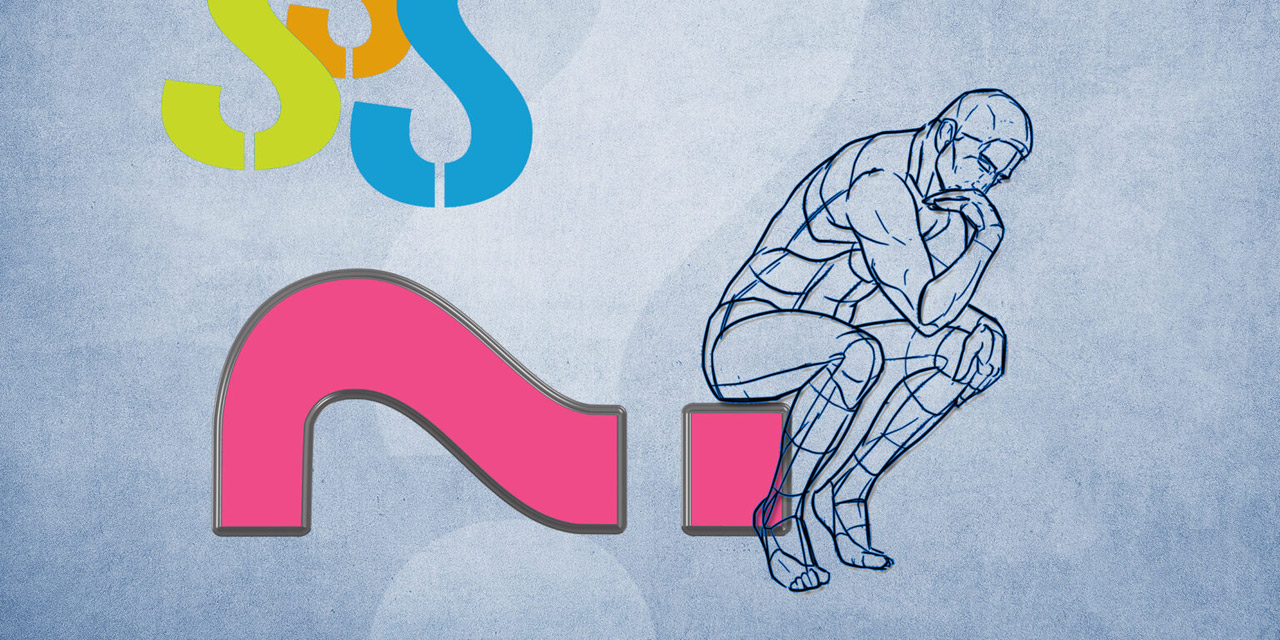Aktuelle Regionalausgabe - Deutsches Handwerksblatt 04 | 2024

In der Aprilausgabe des Deutschen Handwerksblattes berichten wir über die Auslandspraktika Ostbrandenburgischer Lehrlinge im südfranzösischen Albi. Wir besuchten eine Bootswerft in Boitzenburg, begleiteten die Landrätin der Uckermark zu Betrieben in Schwedt und Angermünde und porträtieren Marian Kämpfe. Der junge Fotograf aus Bad Saarow nutzt KI höchst erfolgreich im Arbeitsalltag. Außerdem blicken wir auf die jüngsten Freisprechungen – über 250 junge Menschen erhielten jüngst in Prenzlau, Eberswalde und Fürstenwalde ihre Gesellenbriefe. Wie immer finden Sie im Blatt Informationen zu Terminen, neuen gesetzlichen Regelungen, jede Menge Weiterbildungsangebote und eine Übersicht über aktuelle Meisterkurse. Also: Reinschauen lohnt sich!
So erreichen Sie uns
Apps

Handwerkerradar Im direkten Umfeld oder in der Region: Handwerksbetriebe in der Nähe finden.

Sachverständigenradar Schnell und unkompliziert qualifizierte Gutachter im Handwerk finden.

Lehrstellenradar Informationen zu freien Ausbildungsplätzen direkt auf dem Smartphone.

AppZubi Die App begleitet digital zum Start und während der Ausbildung.
Veranstaltungen
Newsletter